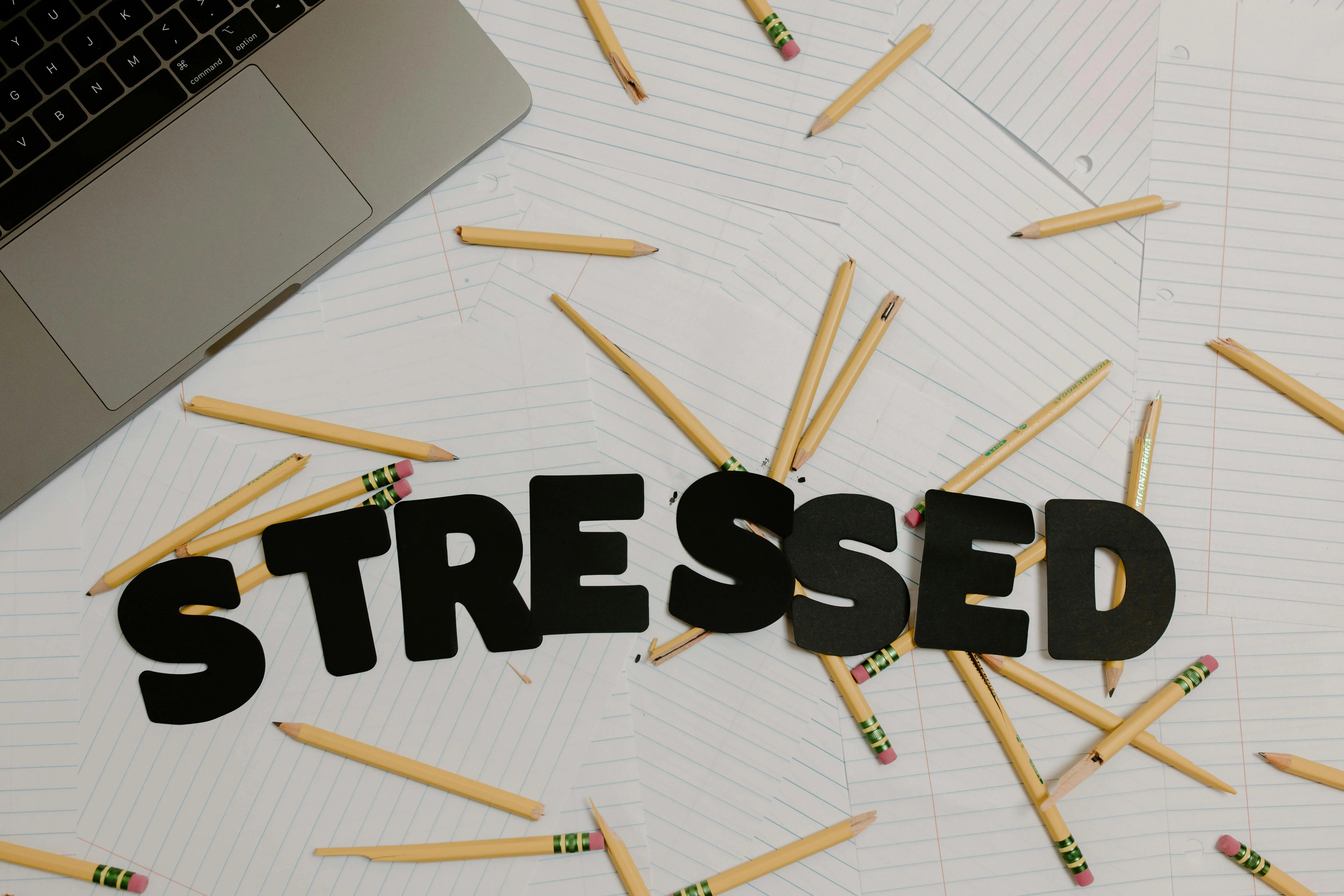Das gefährliche Bündnis zweier Proteine
Manchmal ist es nicht das, was fehlt, sondern das, was sich falsch verbindet. Eine neue Studie der Rockefeller University zeigt, dass zwei Eiweiße – Amyloid-Beta und Fibrinogen – im Zusammenspiel eine verheerende Wirkung auf das Gehirn entfalten. In winzigen Mengen, die für sich genommen harmlos wären, führen sie gemeinsam zu massiven neuronalen Schäden – und beschleunigen damit Alzheimer-Prozesse deutlich.
Diese Erkenntnis bringt nicht nur ein neues Puzzlestück in das komplizierte Bild der Krankheit, sondern auch neue Hoffnung für Therapien, die frühzeitig ansetzen – lange bevor Gedächtnisverlust und kognitive Ausfälle sichtbar werden.
Wenn Amyloid Fibrinogen trifft
Amyloid-Beta (Aβ) und Tau-Proteine gelten seit Jahrzehnten als die zentralen „Tatverdächtigen“ der Alzheimer-Forschung. Doch die simple Formel „zu viel Amyloid – gleich Alzheimer“ greift zu kurz. Die Forscher um Prof. Sidney Strickland und Dr. Erin Norris zeigen nun, dass Amyloid-Beta 42, die besonders toxische Variante des Peptids, mit einem weiteren Protein eine gefährliche Allianz eingeht: Fibrinogen.
Fibrinogen ist eigentlich ein harmloser Bestandteil des Bluts. Es sorgt für die Blutgerinnung, indem es bei Verletzungen in Fibrin umgewandelt wird – eine Art körpereigenes Pflaster. Im Gehirn sollte es jedoch nichts zu suchen haben. Erst wenn die Blut-Hirn-Schranke, jene feine Schutzbarriere zwischen Kreislauf und Nervenzellen, durchlässig wird – wie es im Verlauf von Alzheimer häufig geschieht – gelangt Fibrinogen in Hirngewebe. Dort trifft es auf Amyloid-Beta. Und dieses Zusammentreffen hat fatale Folgen.
Kleine Mengen, große Wirkung
Um die Wirkung zu untersuchen, setzten die Forscher auf ein raffiniertes Modell: Sie verwendeten winzige Scheiben aus dem Hippocampus von Mäusen – dem Bereich, in dem Erinnerungen entstehen. Diese „organotypischen Hirnschnitte“ blieben am Leben und reagierten auf die Zugabe verschiedener Proteinmischungen.
Das Ergebnis war verblüffend: Weder Amyloid-Beta noch Fibrinogen allein verursachten bei niedrigen Konzentrationen sichtbare Schäden. Doch sobald beide Moleküle als Komplex zusammenwirkten, brachen synaptische Marker – die Messgröße für gesunde neuronale Kommunikation – massiv ein. Schon winzige Mengen des Duos führten zu demselben Schaden wie hohe Dosen von Amyloid allein.