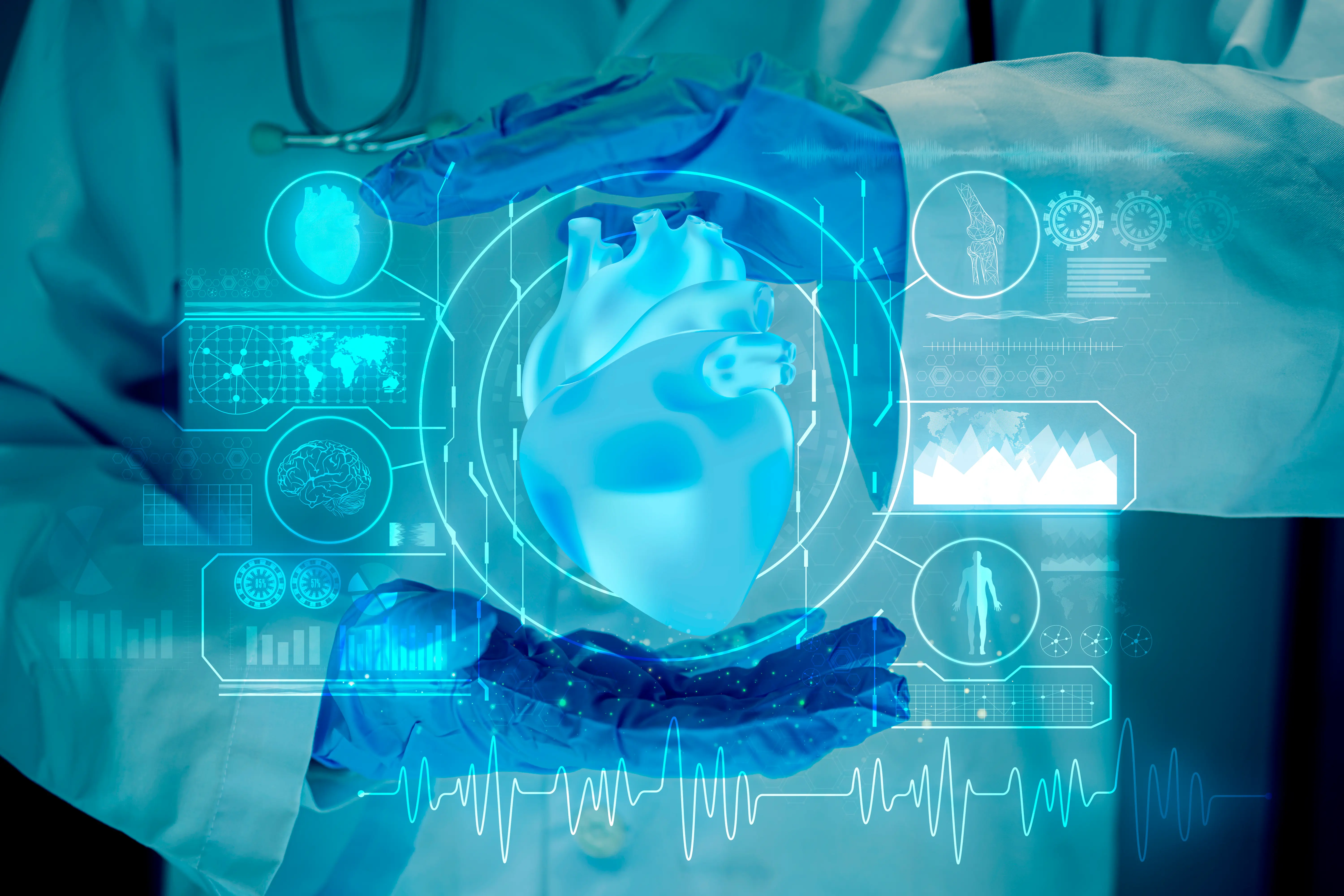
© PMC
Funktionelle Diagnostik und Bildgebung
Funktionale Diagnostik und Bildgebung
Funktionale Diagnostik und bildgebende Verfahren sind zwei zentrale Säulen innerhalb der medizinischen Diagnostik. Sie liefern unterschiedliche, aber sich oft ergänzende Informationen über den Zustand von Organen, Geweben und Körperfunktionen, wodurch der Arzt ein möglichst umfassendes Bild vom Zustand des Patienten erhält. So wird etwa bei Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit eine funktionelle Belastungsuntersuchung mit bildgebender Darstellung der Herzkranzgefäße kombiniert. Beide Methoden zusammen ermöglichen eine präzisere Diagnosestellung, bessere Verlaufskontrolle und individuell angepasste Therapieentscheidungen. Unter funktionaler Diagnostik versteht man Untersuchungen, die die Leistungsfähigkeit und Funktionsweise von Organen oder physiologischen Systemen bewerten. Im Gegensatz zur rein strukturellen Bildgebung geht es hier nicht nur darum, ob ein Organ anatomisch intakt ist, sondern ob es auch korrekt arbeitet. Ein klassisches Beispiel ist das EKG (Elektrokardiogramm), mit dem die Aktivität des Herzens aufgezeichnet wird. Weitere typische Verfahren sind die Lungenfunktionsprüfung, bei der Atemvolumen- und Luftstromgeschwindigkeit gemessen werden, oder die Ergometrie, bei der das Herz-Kreislauf-System unter Belastung getestet wird. Auch Langzeitmessungen wie das 24-Stunden-Blutdruckprofil oder das Langzeit-EKG gehören zur funktionalen Diagnostik. Demgegenüber steht die bildgebende Diagnostik, bei der mithilfe technischer Verfahren visuelle Darstellungen von Strukturen im Körperinneren erzeugt werden. Ziel ist es, Anatomie, Veränderungen, Läsionen oder pathologische Prozesse sichtbar zu machen. Zu den wichtigsten bildgebenden Verfahren zählen die Röntgendiagnostik, die Sonografie (Ultraschall), die Computertomografie (CT), die Magnetresonanztomografie (MRT) und die Nuklearmedizin (z. B. PET- oder Szintigrafie). Während Röntgen und CT vor allem für Knochen und Lungen geeignet sind, liefert die MRT detaillierte Bilder von Weichteilgeweben wie Gehirn, Rückenmark, Muskeln oder Gelenken. Die Sonografie kommt häufig bei der Untersuchung von Bauchorganen, Gefäßen oder dem Herzen (als Echokardiografie) zum Einsatz. Nuklearmedizinische Verfahren ermöglichen es sogar, Stoffwechselvorgänge sichtbar zu machen, z. B. die Verstoffwechselung von Glukose in Tumorgewebe.

_1500x2250_150_RGB-2.webp)







