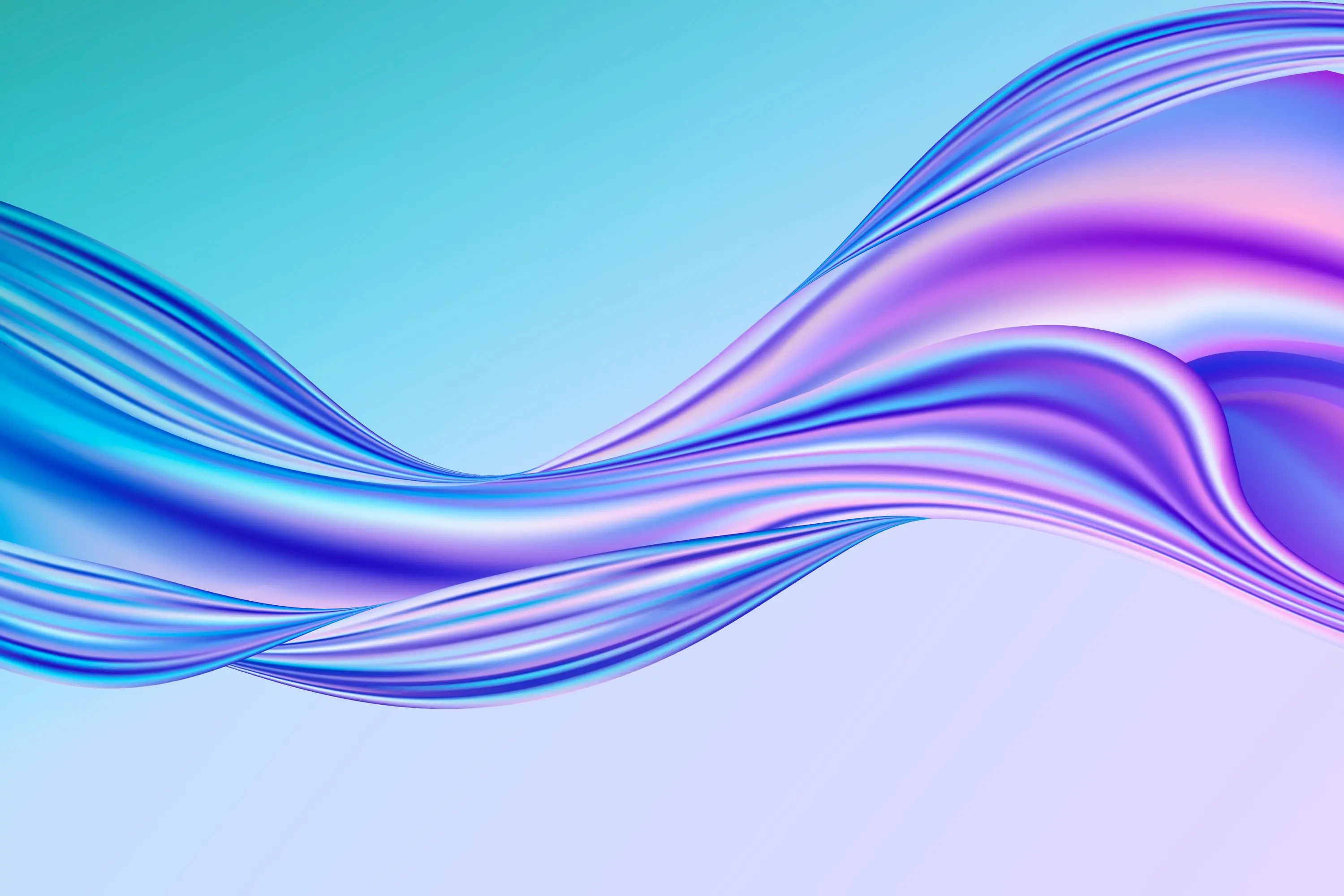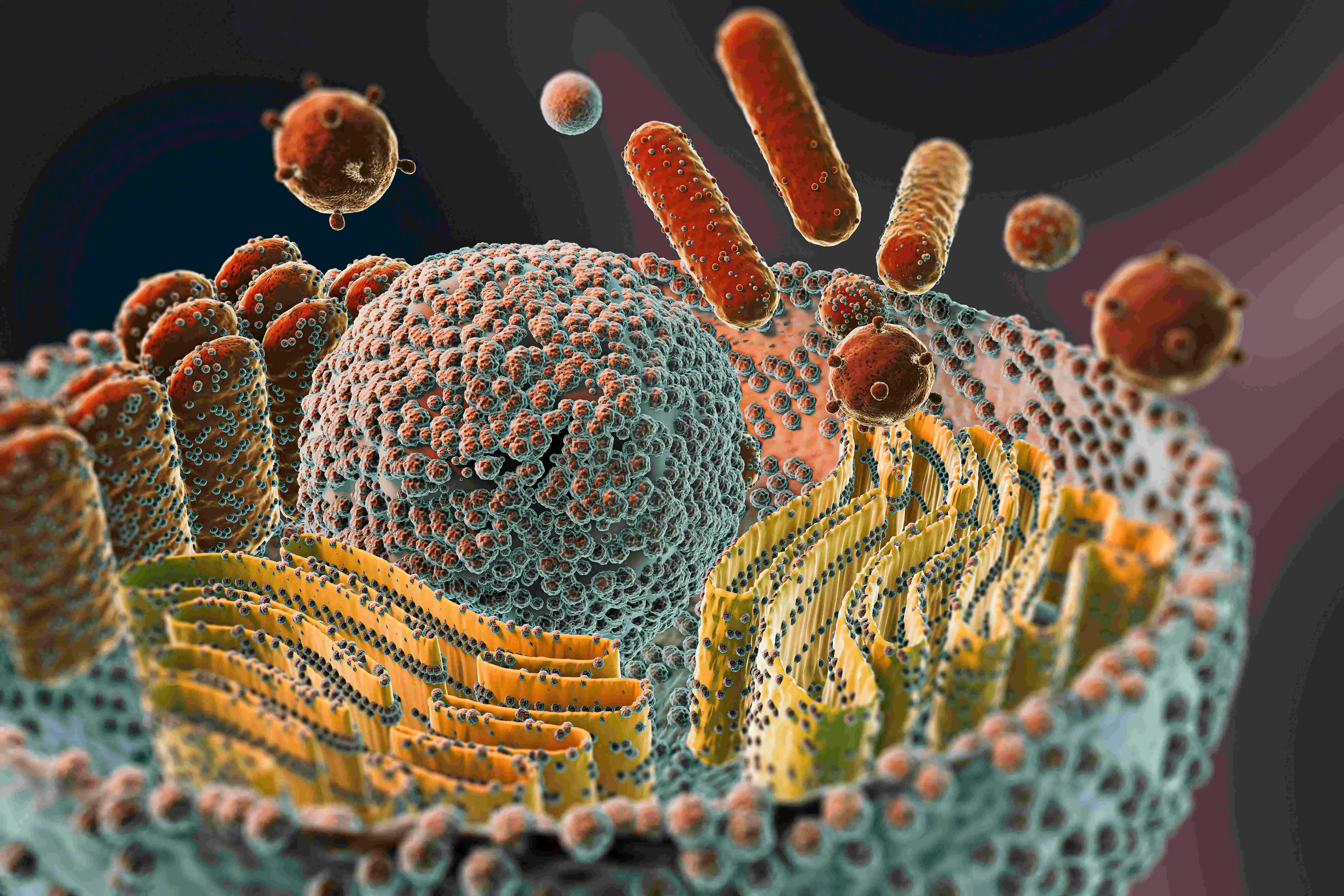Was ist Flow? Die Entdeckung von Mihály Csíkszentmihályi
Der Begriff „Flow“ wurde in den 1970er-Jahren von Mihály Csikszentmihályi, damals Professor für Psychologie in Chicago und einer der Mitbegründer der Positiven Psychologie, geprägt. Er forschte darüber, wann Menschen wirklich glücklich sind. Dazu beobachtete er über Jahrzehnte hinweg Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, zunächst eine Gruppe von KünstlerInnen und TänzerInnen, deren absolute Hingabe an ihre Arbeit ihn faszinierte.
Später kamen weitere Berufe hinzu, sogar Himalaya-Bergsteiger oder Navajo-Schäfer waren darunter – insgesamt wurden weltweit rund 8000 Interviews geführt.
Das Ergebnis: Unabhängig von Kultur, Bildung oder anderen Faktoren erlebten alle Befragten besonders dann ein intensives Glücksgefühl, wenn sie ganz in einer Tätigkeit aufgingen. Womit auch immer die Befragten sich beschäftigten, es waren immer dieselben sieben Kriterien, die einen Flow-Zustand kennzeichneten.
Die 7 Merkmale des Flow-Zustands
1. Absolute Fokussierung auf eine Sache.
2. Ein Gefühl wie ein Rausch.
3. Völlige innere Klarheit – man weiß genau, was zu tun ist und welcher Schritt als nächster folgt.
4. Es erscheint mühelos.
5. Das Zeitgefühl verschwindet, Hunger, Durst oder Müdigkeit werden ausgeblendet.
6. Man hat das Gefühl, über sich hinauszuwachsen und
7. Teil von etwas Größerem zu sein.
Flow im Gehirn: Die Neurobiologie der Höchstleistung
Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist Flow eine Art Ausnahmezustand. Das Gehirn ist voll im „Performance- Modus“: kreativ, fokussiert und effizient – zugleich erstaunlich gelassen. Der präfrontale Cortex, der Meister der Selbstkritik und Planung, geht dann mehr oder weniger offline. Möglich wird das durch einen Cocktail aus Dopamin, Noradrenalin und Endorphinen – Botenstoffe, die Motivation, Klarheit und Zufriedenheit verstärken. Mihály Csikszentmihalyi selbst nannte das Flow-Erleben auch eine „positive Sucht“.
"In the Zone": Wie Spitzensportler Flow erleben
SportlerInnen sprechen oft davon, „in the zone“ zu sein. Dann fühlt sich der Flow wie eine Superkraft an – so formulierte es Basketball-Legende LeBron James. Michael Jordan sagte einmal: „Wenn ich in der Zone bin, denke ich nicht an das Spiel, das Spiel kommt einfach zu mir und alles andere ist einfach blockiert.“
Auch Tennis-Profi Serena Williams äußerte sich ähnlich. Sprinter Usain Bolt brachte es auf den Punkt: „Man denkt nicht an den Start des Rennens, das Ziel oder die Zuschauermenge. Du rennst einfach.“ Formel-1-Pilot Ayrton Senna beschrieb eine Flow-Erfahrung beim Grand Prix von Monaco 1988, als er plötzlich zwei Sekunden schneller fuhr als das gesamte Rest des Feldes: „Plötzlich realisierte ich, dass ich das Auto nicht mehr bewusst steuere, sondern eine Art Instinkt, ich war in einer anderen Dimension. Es war wie in einem Tunnel.“