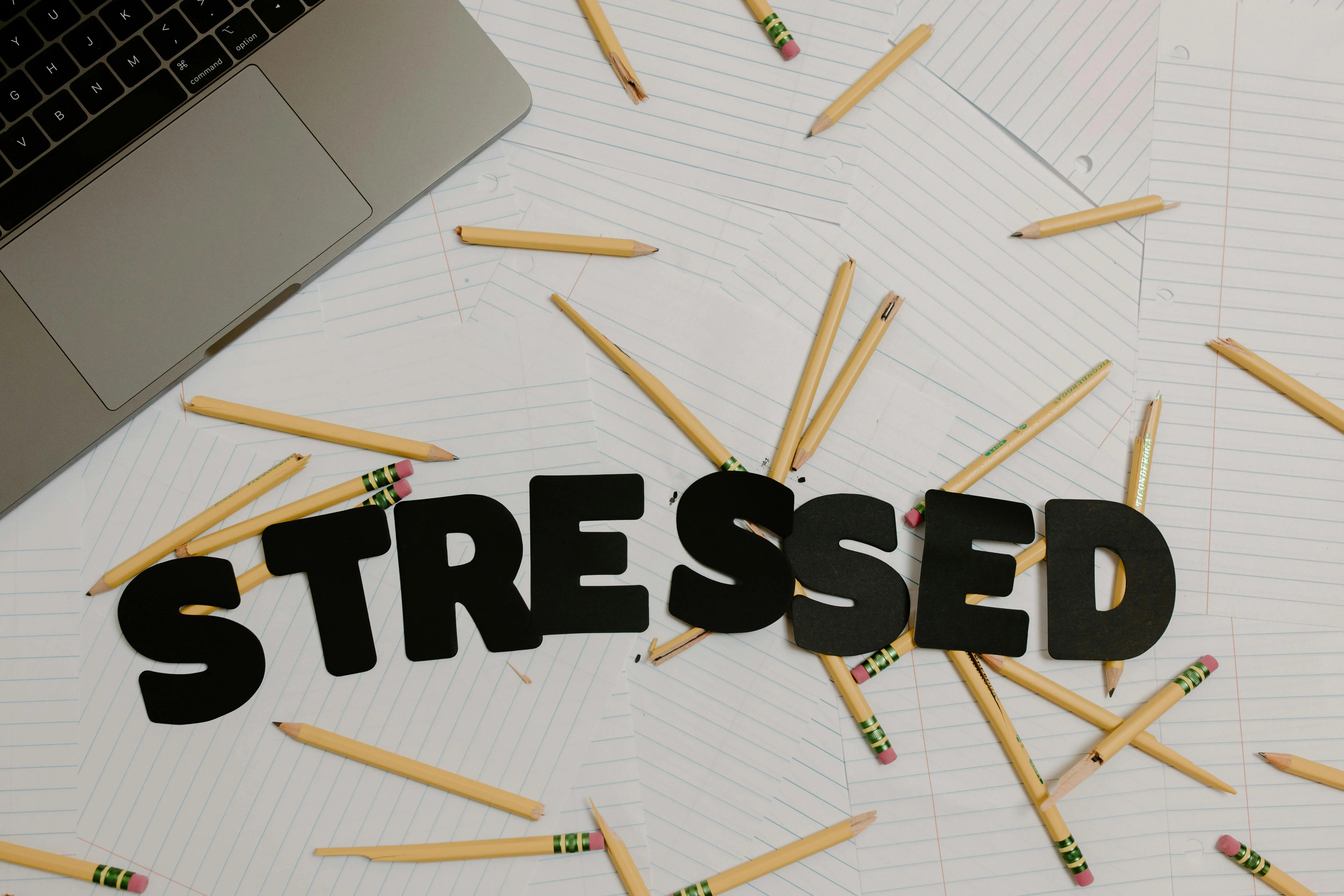Zimt gehört zu den ältesten Gewürzen der Welt und wurde bereits in der Antike als kostbares Handelsgut geschätzt. Heute würzen wir damit nicht nur Desserts und Heißgetränke, sondern zunehmend auch herzhafte Gerichte. Doch das braune Pulver kann offenbar mehr als nur gut schmecken – die Forschung beschäftigt sich intensiv mit seinen gesundheitlichen Effekten.
Zwei Sorten, ein großer Unterschied
Zunächst ist wichtig zu wissen: Zimt ist nicht gleich Zimt. Im Handel finden sich hauptsächlich zwei Varianten. Der günstigere Cassia-Zimt stammt vorwiegend aus China, Vietnam oder Indonesien und hat einen kräftigen, leicht scharfen Geschmack. Der hochwertigere Ceylon-Zimt, auch als "echter Zimt" bezeichnet, kommt aus Sri Lanka und schmeckt feiner und süßlicher.
Der entscheidende Unterschied liegt im Gehalt an Cumarin, einem natürlichen Pflanzenstoff. Cassia-Zimt enthält davon deutlich mehr – und genau hier liegt das Problem: In höheren Dosen kann Cumarin die Leber belasten und sollte daher nicht in großen Mengen konsumiert werden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als zwei Gramm Cassia-Zimt täglich zu verzehren. Ceylon-Zimt hingegen enthält nur Spuren von Cumarin und kann bedenkenloser verwendet werden.
Was steckt drin?
Zimt enthält eine Vielzahl bioaktiver Substanzen. Besonders interessant sind die Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativen Eigenschaften. Diese können freie Radikale abfangen und damit oxidativen Stress reduzieren – ein Mechanismus, der bei der Entstehung chronischer Erkrankungen eine Rolle spielt.
Darüber hinaus liefert Zimt ätherische Öle, vor allem Zimtaldehyd, das für den charakteristischen Duft und Geschmack verantwortlich ist. Hinzu kommen kleine Mengen an Mangan, Eisen und Calcium.
Blutzucker im Fokus
Besonders intensiv erforscht wird die mögliche Wirkung von Zimt auf den Blutzuckerspiegel. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass regelmäßiger Zimtkonsum die Insulinsensitivität verbessern und den Nüchternblutzucker senken könnte. Der Mechanismus dahinter ist noch nicht vollständig geklärt, vermutet wird jedoch eine Beeinflussung der Insulinrezeptoren und des Glukosestoffwechsels.
Für Menschen mit Typ-2-Diabetes oder Prädiabetes könnte Zimt daher eine interessante Ergänzung sein – allerdings keinesfalls als Ersatz für Medikamente oder eine ausgewogene Ernährung. Die Studienlage ist noch nicht eindeutig genug für klare medizinische Empfehlungen, und die Effekte fallen individuell unterschiedlich aus.