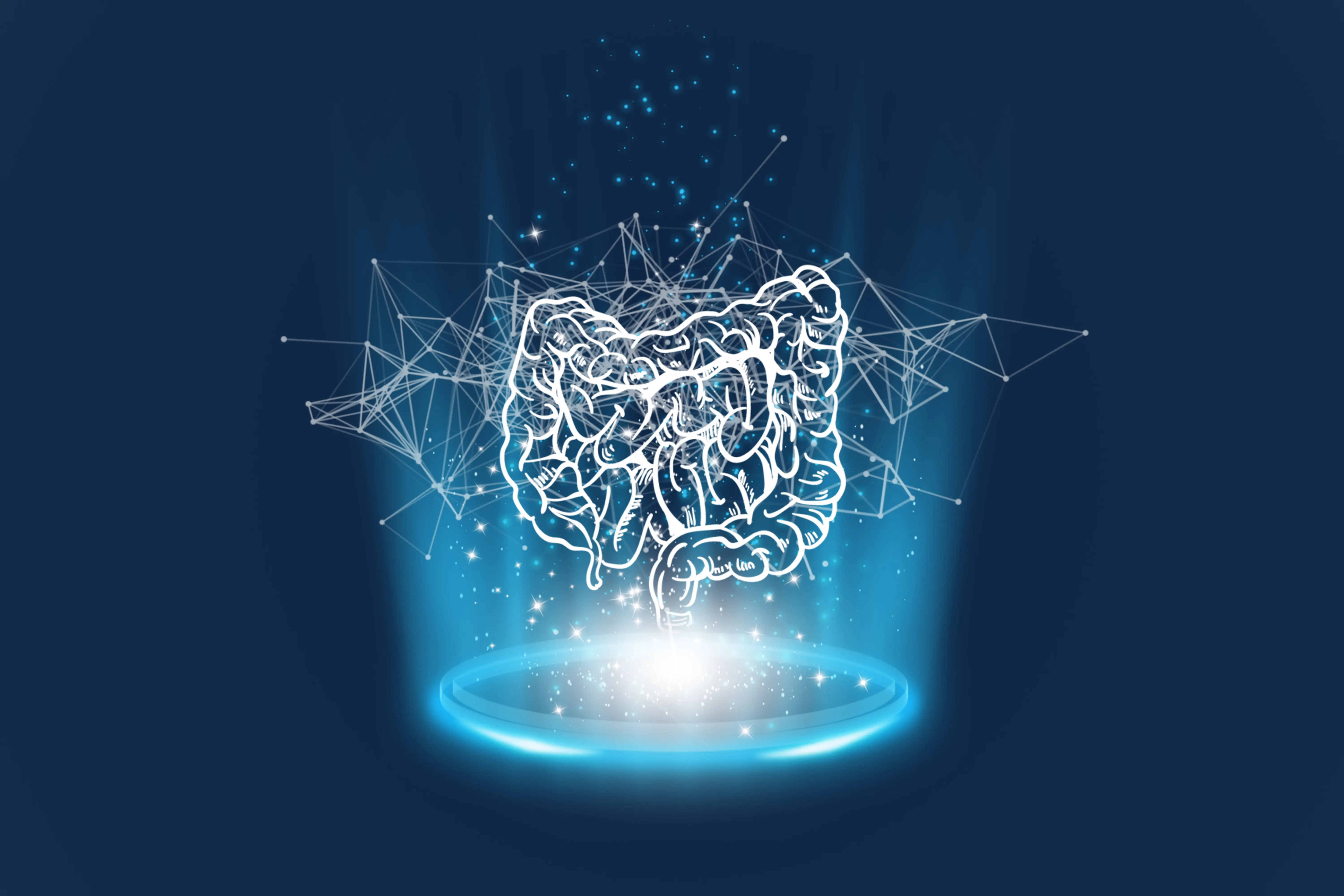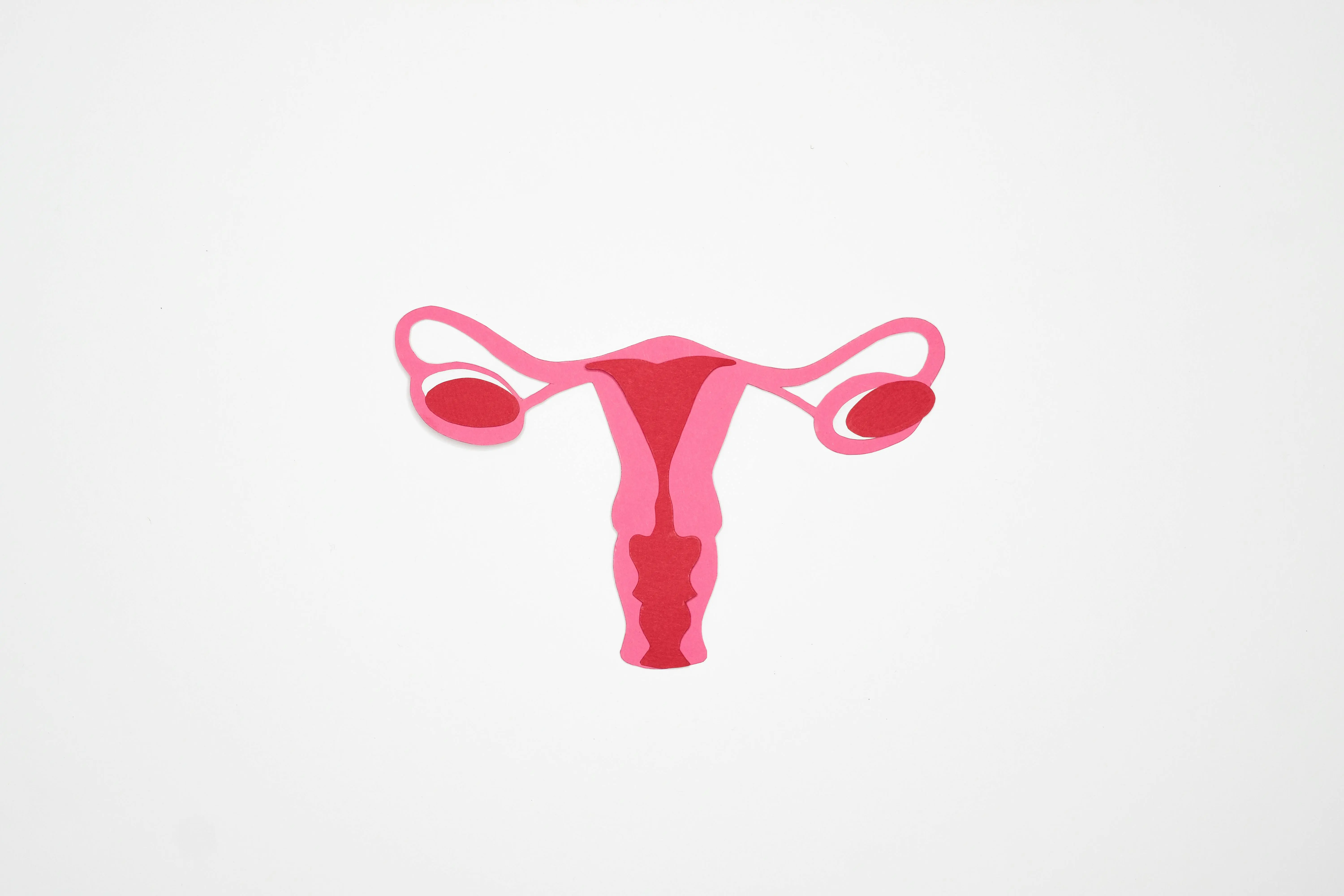Erst ist es nur das Glas Wein oder das Feierabendbier, das für Entspannung sorgen soll. Der Joint, der den Spaßfaktor steigert. Oder die Schlaftablette, die das nächtliche Gedankenkarussell zum Stoppen bringt. Doch nach und nach können aus den noch so harmlosen kleinen Verführungen gefährliche Gewohnheiten entstehen.
"Am Anfang einer Sucht stehen häufig die Neugier, der Gruppenzwang oder der Wunsch, bestimmte Emotionen oder Stress abzubauen“, so PD Dr. Eva Döring-Brandl, MBA, Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe in Berlin. Dabei gibt es meist noch keine deutlich erkennbaren negativen Konsequenzen.
Doch im weiteren Verlauf, wenn das abendliche Glas Wein zum festen Entspannungsritual wird, entwickelt sich ein Gewohnheitskonsum. Zur Sucht wird es erst, wenn die Menge steigt und der Konsum mit Kontrollverlust oder anderen negativen Folgen einhergeht.
Rund neun Millionen Menschen in Deutschland konsumieren Alkohol in einer problematischen Form
„Daraus entwickelt sich die eigentliche Abhängigkeit – sowohl psychisch als auch physisch“, so die Expertin für Suchtverhalten. „Dieser Prozess ist sehr heterogen, verläuft oft schleichend und über Jahre bis Jahrzehnte, was es in vielen Fällen so schwer macht, die Entwicklung einer Sucht zu bemerken.“
Rund neun Millionen Menschen in Deutschland konsumieren laut „Jahrbuch der Sucht 2025“ Alkohol in einer problematischen Form. Der zweithäufigste Anlass für den Zugang zu Suchthilfeangeboten sind cannabinoidbezogene Störungen.
Warum Menschen in die Sucht geraten, kann verschiedenste Gründe haben. Die biologische Ebene ist dabei ebenso wichtig wie die psychische. Zunächst steckt, wie bei jedem Verlangen, das klassische Belohnungssystem im Gehirn dahinter. Eine Schlüsselrolle kommt hier dem Dopamin zu: Der Neurotransmitter motiviert uns, immer wieder nach Reizen zu suchen, die uns ein gutes Gefühl geben. In diesem Fall eine der genannten Substanzen.
Und wenn wir damit das nächste Mal in Kontakt kommen, wird dies sozusagen vom Dopamin geliked und positiv abgespeichert. Der Grundstein zu einer Fehlsteuerung des Belohnungssystems ist gelegt. Irgendwann beginnt der Kick nachzulassen: Was anfangs aufregend und spannend war, verliert seine Wirkung.
Statt der ursprünglich erlebten Erregung gibt es nur noch das Verlangen nach der nächsten Dosis – um das Belohnungsdefizit zu kompensieren. Je öfter dieser Prozess wiederholt wird, desto stärker wird das Bedürfnis, es erneut zu tun. So wird der Substanzkonsum mehr und mehr zum Mittel, um mit verschiedenen Lebenslagen und Gemütszuständen umzugehen.