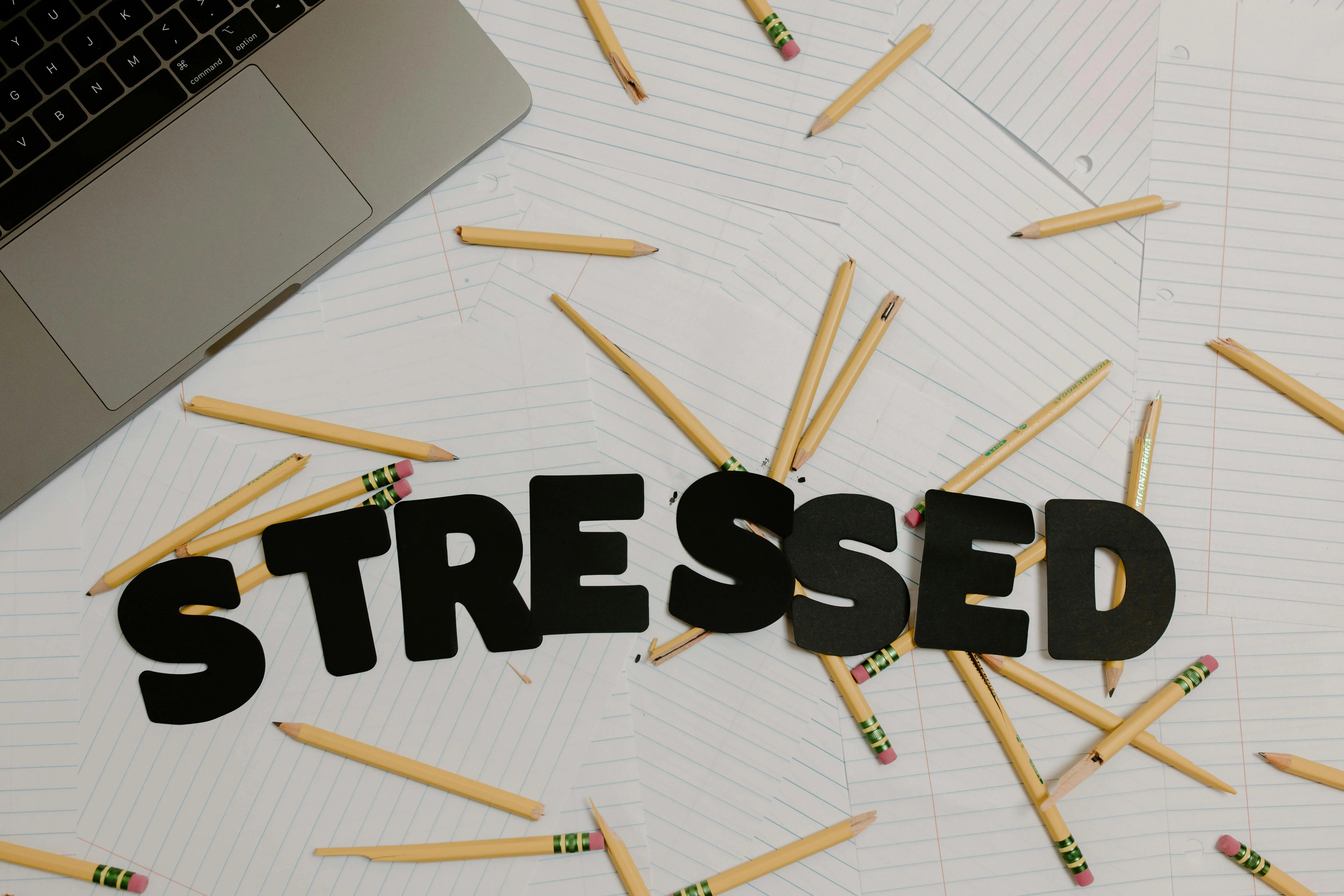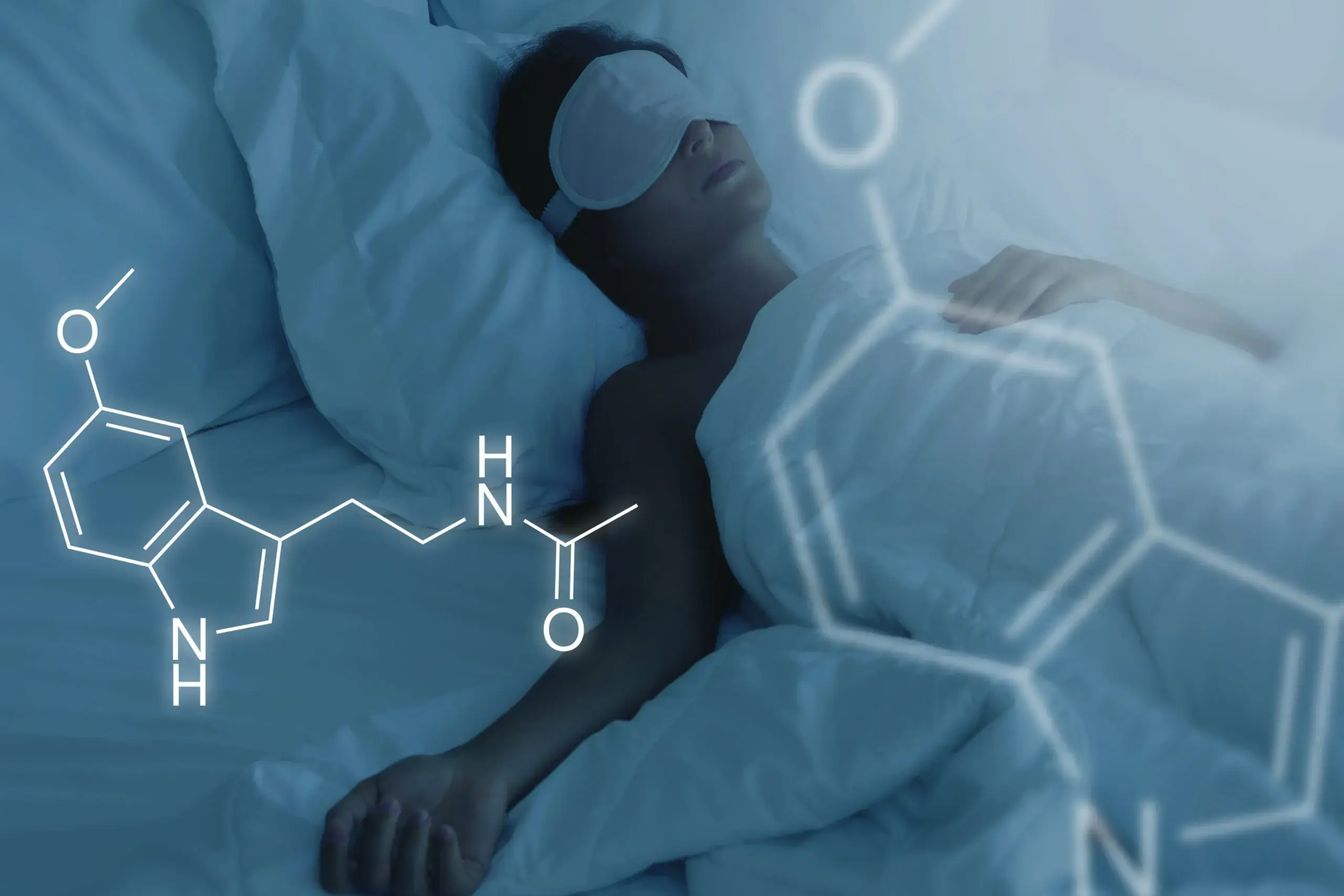Beim Thema Kaffee scheiden sich die Studien: Einige Wissenschaftler sehen negative Folgen durch den Genuss für die Gesundheit, andere sind überzeugt von seiner Wirkung auf Körper und Geist. 1991 setzte die Weltgesundheitsorganisation Kaffee sogar auf die Liste möglicher krebserregender Substanzen, 2016 wurde er allerdings rehabilitiert. Was stimmt nun: Ist Kaffee gesund oder schädlich? Oder etwa beides? Ein Faktencheck.
Eines ist schon einmal sicher: Neben Wasser ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen. 2024 lag der Pro-Kopf-Verbrauch laut dem Deutschen Kaffeeverband bei rund 163 Litern. Das entspricht knapp vier Tassen pro Tag.
Welche Wirkung hat Kaffee auf den Körper?
Die Beliebtheit des schwarzen Heißgetränks ist natürlich vor allem seiner durchschlagenden Hallo-Wach-Wirkung geschuldet – und auch seinem Aroma. Für den Energy-Boost sorgt das im Kaffee enthaltene Koffein. Das Alkaloid stimuliert das zentrale Nervensystem, es erhöht außerdem Puls und Blutdruck, regt den Stoffwechsel und die Verdauung an. Außerdem steigert es die Konzentrationsfähigkeit, erhöht die Aufmerksamkeit und verbessert die Leistungsfähigkeit. Die belebende Wirkung hält meist mehrere Stunden an und lässt nach durchschnittlich vier Stunden nach.
Kaffee: Wieviel am Tag ist gesund?
Mit Koffein verhält es sich wie mit vielen anderen Dingen: Die Dosis macht das Gift. In kleinen Mengen genossen, sorgt Koffein für den erhofften Energie-Turbo, in hohen Konzentrationen – laut Studien über 400 mg pro Tag – führt Koffein zu Nervosität, Angstzuständen und Schlaflosigkeit.
Die richtige Dosierung einzuschätzen, ist aber gar nicht so einfach. Denn wie viel Koffein wirklich in einer Tasse Kaffee steckt, weiß man in der Regel nicht. Dieses hängt nämlich von der Zubereitungsart und der Kaffeesorte ab und – logisch – von der Größe der Tasse ab.
Allein schon die zwei hauptsächlich angebauten Kaffeesorten Arabica und Robusta unterscheiden sich in ihrem Koffeingehalt erheblich, denn Robusta enthält fast doppelt so viel Koffein wie Arabica. Die Faustregel fällt also recht wässrig aus: Eine Tasse mit 150 ml Filterkaffee hat 50-100 mg Koffein in sich. Ein starker Espresso (50 ml) enthält bis zu 150 mg Koffein. Und in einem entkoffeinierten Kaffee stecken immerhin auch noch 3 mg Koffein.
Betrachtet man die eine normale Kaffeetasse als Dosierungshilfe sind laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung drei bis vier Tassen – bei Schwangeren und Stillenden ein bis zwei – unbedenklich. Der deutsche Konsum bewegt sich also noch im grünen Bereich.