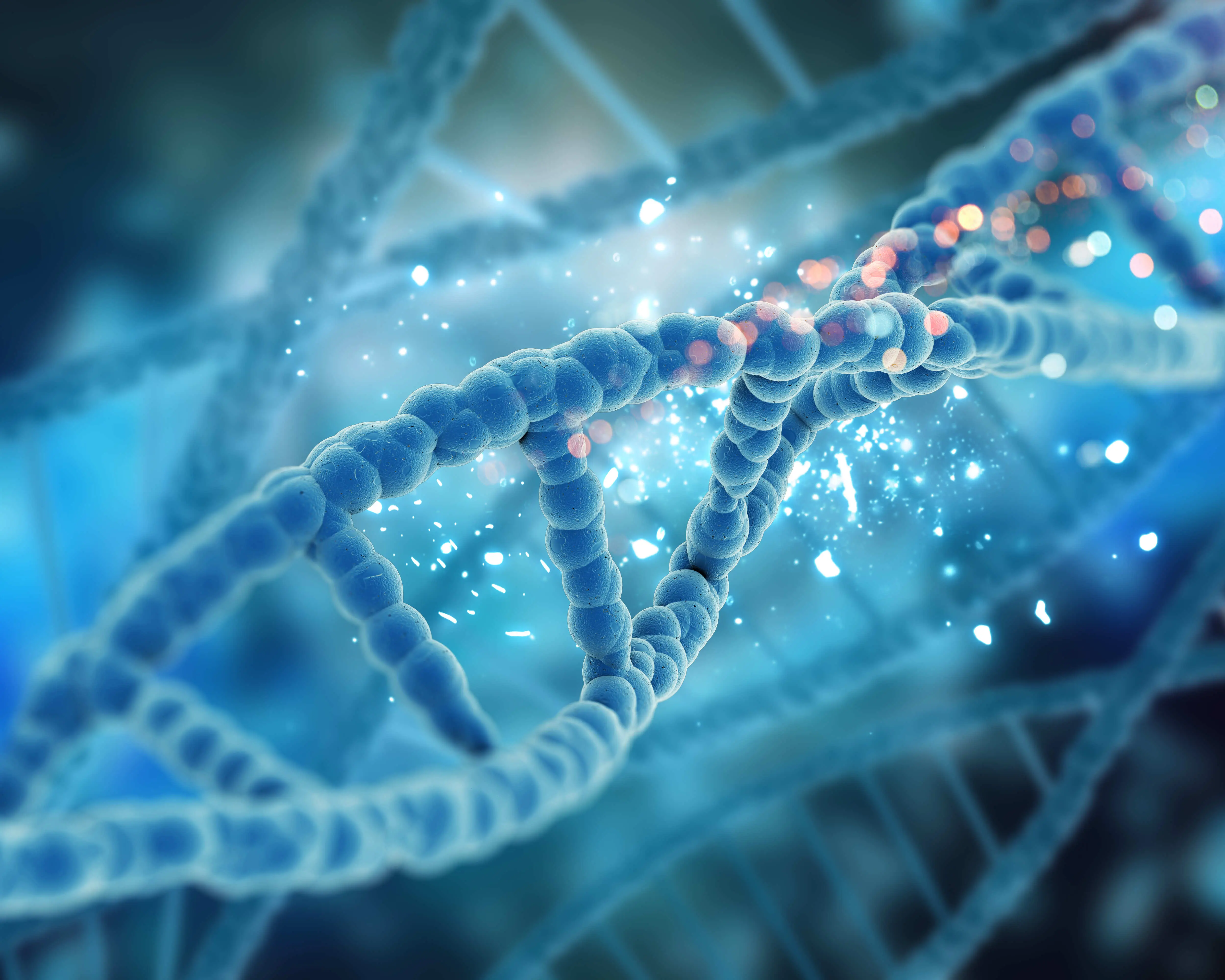15. April 2025
Margit Hiebl
- Health
Warum träumen wir?
Etwa sechs Jahre unseres Lebens träumen wir. Doch wozu dienen diese nächtlichen Sondervorstellungen des Gehirns und wie entstehen sie?
Paul McCartney, so heißt es, hat „Yesterday“ angeblich im Schlaf geschrieben. Genauso ging es auch Keith Richards mit „Satisfaction“. Chemiker Friedrich August Kekulé von Stradonitz erschien die Struktur des Benzolmoleküls während eines Nickerchens. Schön, wenn solche Träume wahr werden. Aber auch von weniger schönen Traumgeschehnissen wird berichtet: So soll Abraham Lincoln geträumt haben, einem Attentat zum Opfer zu fallen, drei Tage bevor es tatsächlich passierte. Dass Träume verschlüsselte Botschaften sind, daran glaubten Menschen lange Zeit. In allen Religionen wimmelt es von solch prophetischen Träumen und nächtlichen Botschaften. Der Urvater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, dachte, Träume entspringen dem Unterbewusstsein und bringen intimste Gedanken und Emotionen zum Vorschein.
Doch was sind Träume?
Heute geht die Traumforschung davon aus, dass sie eine zufällige Mischung aus erlebten Dingen und der Verarbeitung von Gefühlen sind. Eine andere Theorie besagt, dass Träume auf reale Situationen vorbereiten, indem man – vereinfacht gesagt – gefährliche Situationen oder Probleme gefahrlos durchspielen und Reaktionen darauf üben kann. Auf neurowissenschaftlicher Ebene konnte mithilfe von EEG und MRT gezeigt werden, dass es Parallelen zwischen Wach- und Traumzustand gibt, da bei bestimmten Bewegungen im Traum die gleichen motorischen Zentren im Gehirn aktiviert werden. Aktiv sind auch die Bereiche, die für die visuelle Wahrnehmung und das emotionale Empfinden zuständig sind.
Wissenschaftler gehen davon aus, dass das limbische System – das für Emotionen bedeutsam ist – eine zentrale Rolle spielt, während der präfrontale Kortex, der für logisches Denken verantwortlich ist, weniger aktiv ist. Dadurch entstehen oft surreal wirkende Szenarien. Sicher ist: Träume sind ein Produkt unseres Gehirns. Es verarbeitet im Schlaf Informationen, die tagsüber aufgenommen wurden, und speichert sie ab. Manchmal färbt das auf den Traum ab, manchmal nicht. Stress und Sorgen jedoch führen oft zu besonders intensiven und/oder negativen Träumen. Umgekehrt beeinflussen die Träume auch unser emotionales Gleichgewicht: Angenehme Träume fördern Entspannung und Kreativität, Albträume hingegen können zu Stress und Ängsten führen.
Heute geht die Forschung davon aus, dass Träume eine zufällige Mischung aus erlebten Dingen und der Verarbeitung von Gefühlen sind
REM-Phase – was war das noch mal?
Besonders intensiv ist das Traumgeschehen in der sogenannten REM-Phase (Rapid Eye Movement), in der sich die Augen rasch hin und her bewegen. Die Wissenschaft geht davon aus, dass man wahrscheinlich die ganze Nacht durchträumt – wobei ein Traum zwischen 5 und 20 Minuten dauert –, aber nicht alles gleich gut erinnert. Und in den Non-REM-Phasen träumt man nicht so bunt und lebendig. Inzwischen ist es Forschenden an der Universität Kyoto gelungen, mithilfe von Hirnscans filmähnliche Sequenzen aus den Köpfen der Schlafenden zu generieren – die häufig mit den anschließend geschilderten Traumerlebnissen übereinstimmten.
Soweit sie sich daran erinnerten. Denn auch das ist nicht selbstverständlich. Obwohl wir jede Nacht mehrere Träume haben, erinnern wir uns nur an wenige oder oft gar nicht – besonders wenn wir aus dem Tiefschlaf aufwachen. Doch die Erinnerung an Träume lässt sich lernen: indem man gleich nach dem Aufwachen den Traum in den Gedanken durchgeht und aufschreibt. Dazu legt man am besten Zettel und Stift neben dem Bett bereit. Dabei notiert man nicht nur die Bilder, sondern ebenso Gerüche, Geräusche oder aufkommende Gefühle, bevor sie verschwinden. Je regelmäßiger man das macht, desto besser und detaillierter werden Träume erinnert. Ein Traumtagebuch hilft dabei, mit Träumen zu arbeiten, etwa bei Albträumen oder luziden Träumen.

© Freepik
Ein Traumtagebuch hilft dabei, mit Träumen zu arbeiten
Albträume – was für ein Horror
Albträume sind die dunkle Seite der Nacht. Der Begriff kommt von den Elfen aus der germanischen Mythologie, den „Alben“, die für die Träume verantwortlich gewesen sein sollen. Der Vorstellung nach hockten sie auf der Brust des Schlafenden – daher kommt der sogenannte Albdruck. Tatsächlich hockt so ein mutmaßlicher Alb nachts bei fünf bis zehn Prozent aller gesunden Erwachsenen – bei Frauen dreimal häufiger als bei Männern. Albträume treten häufig während der REM-Phase auf. Der Vorteil: Es sind nur die Augenbewegungen aktiv, während alle anderen Muskeln entspannt sind – das verhindert, dass der Träumende beim Kampf mit dem Monster tatsächlich aktiv wird und sich womöglich verletzt.
Der Nachteil: Diese Unfähigkeit zur Aktion kann sich direkt im Traum bemerkbar machen, indem man sich nicht fortbewegen oder fliehen kann. Zu den häufigsten Albtraumthemen zählt übrigens der Fall ins Bodenlose, gefolgt von Prüfungen und Versagensangst, Nacktsein in der Öffentlichkeit, Verfolgung, Verletzung und dem Tod von Nahestehenden – Angst ist also das vorherrschende Thema.
Wie entstehen Albträume?
In Studien konnte gezeigt werden, dass ein genetischer Faktor eine Rolle spielt. Auch, dass „dünnhäutigere“ Menschen anfälliger dafür sind. Außerdem scheint das aktuelle Stressniveau Einfluss zu haben. Albträume können zudem als Nebenwirkung von Medikamenten auftreten oder im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung, wie Depression oder einer posttraumatischen Belastungsstörung. Selbst äußere Faktoren wie Alkohol, spätes oder scharfes Essen tragen zum nächtlichen Horrorfilm bei, weil sie für Unruhe im Schlaf sorgen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, nachts aufzuwachen und sich an das gerade Geträumte zu erinnern. Denn Albträume tauchen meist in einer späteren Schlafphase auf.
Wie wird man Alpträume los?
Da Albträume immer mit Angst einhergehen, hilft es, sich ihnen zu stellen. Im Rah men einer sogenannten IRT, der Imagery Rehearsal Therapy, kann der Ablauf eines Albtraums im Nachhinein geändert werden. Hier kommt wieder ein Traumtagebuch ins Spiel, in das man, wenn man aus dem Albtraum erwacht, sofort schreibt, was passiert ist – und dies äußerst detailliert, selbst wenn das belastend sein kann. Im nächsten Schritt denkt man sich eine neue Lösung aus, indem man beispielsweise mit der fiesen Traumfigur spricht, sich Helfer dazu denkt oder das unheimliche Parkhaus ausleuchtet. All das schreibt man wieder genau auf. So ergibt sich eine neue, positive Version, die dann eingeübt werden muss: Am besten geht man täglich das Szenario durch und ergänzt es immer wieder – etwa zwei Wochen lang, dann sollte sich die neue Variante in der Traumsituation etabliert haben und der Angstkreis, der vielen Albträumen zugrunde liegt, unterbrochen sein.
Aber auch sogenanntes luzides Träumen kann dabei helfen, Albträume umzuprogrammieren. Wiederholen sich Träume den noch immer wieder oder liegt den Albträumen eine posttraumatische Belastungsstörung zugrunde, sollte professionelle Hilfe von Verhaltenstherapeuten, Psychiatern oder einem Schlaflabor gesucht werden. Mehr Info über Anlaufstellen bietet die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin.
Wie kann man Alpträumen vorbeugen?
Alles, was entspannt und guten Schlaf fördert, kann helfen. Und wer daran glaubt, könnte einen Traumfänger aufhängen. Die federgeschmückten Netzobjekte indigener Völker sollen schlechte Träume abfangen, und später werden sie durch die Morgensonne neutralisiert. Die Guten aber dürfen das Netz passieren.

© Freepik
Traumfänger sollen schlechte Träume abfangen
Gibt es luzide Träume?
Luzide oder Klarträume sind die helle Seite der Träume. Das Besondere: Man weiß während des Traumgeschehens, dass man träumt. Dass das funktioniert, wurde in der Wissenschaft lange bezweifelt und eher als kurze Wachepisoden angesehen. Erst Ende der 1980er-Jahre konnten zwei Forscher unabhängig voneinander in Studien im Schlaflabor nachweisen, dass es luzide Träume gibt. Der Unterschied zum Traum: Das Logikzentrum im vorderen Teil des Gehirns ist aktiviert. In Deutschland hat etwa die Hälfte der Bevölkerung schon einmal einen luziden Traum gehabt, ein Fünftel mehr als einmal im Monat und etwa ein Prozent mehrmals pro Woche. Auch luzide Träume treten überwiegend in der REM-Phase auf.
Wie kann man Träume bewusst steuern?
Als gute Klarträumer gelten Menschen, die Meditationserfahrung, gute Traumerinnerung und eine Offenheit für neue Erfahrungen haben. Messungen haben auch gezeigt, dass bei ihnen der präpolare Kortex größer ist. Luzides Träumen will gelernt und geübt werden. Es klappt nicht auf Anhieb, nicht bei jedem und nicht immer. Und man sollte es vielleicht lieber unter vertrauenswürdiger therapeutischer Anleitung machen, statt mithilfe eines Internetkurses.
Luzide Träume helfen beim Mentaltraining
Zu den bekanntesten Techniken, die luzides Träumen fördern, gehört der Reality-Check, der zeigt, ob man träumt oder nicht – er soll den Geist trainieren, den Check während des Träumens zu wiederholen. Oder: das Führen eines Traumtagebuchs – so können Muster und wiederkehrende Traumzeichen erkannt werden. Im Schlaflabor wird häufig die „Wake up-back-to-Bed“-Methode praktiziert: Dann werden Probanden nach etwa sechs Stunden, wenn normalerweise die REM-Phase läuft, geweckt. Sie sollten sich dann an einen Traum erinnern und alle Hinweise, dass es sich um einen Traum gehandelt hat, aufschreiben. Im nachfolgenden Schlaf können dann eventuell ähnliche Symbole identifiziert und bewusst geträumt werden.
Eine weitere Methode ist die sogenannte MILD-Technik (mnemische Induktion luzider Träume). Dabei nutzt man zum (Wieder-)Einschlafen einen Satz wie „Das nächste Mal, wenn ich träume, weiß ich, dass ich träume“ als Induktion – laut Untersuchungen in einem australischen Schlaflabor nach zwei Wochen übrigens die erfolgversprechendste Methode.
Doch wozu braucht man das?
Mal abgesehen von Experimentierfreudigkeit, ist die Anwendung des luziden Träumens interessant für Profisportler. Sie nutzen diese Technik gezielt, um Bewegungsabläufe mental zu trainieren. Eine Studie der Universität Heidelberg aus dem Jahr 2018 ergab, dass Athleten, die im luziden Traum komplexe Bewegungsmuster übten, im realen Training eine teilweise signifikante Leistungssteigerung erzielten. Doch nicht nur Sportlerinnen und Sportler profitieren. Auch Musiker können schwierige Passagen im Traum üben, Künstler neue kreative Ideen entwickeln, Projektleiter Präsentationen durchspielen.
Dies ist deshalb nicht abwegig, weil davon ausgegangen wird, dass die REM-Phase eine Rolle für unser Gedächtnis und die Fähigkeit zu lernen spielt. Für andere kann es der Weg aus der Albtraumschleife sein. Der besondere Reiz von Klarträumen liegt darin, etwas zu tun, was im realen Leben nicht möglich ist. Wer jetzt über eine Beeinflussung der Träume nachdenken sollte, wie im Film Inception, in dem sich Leonardo DiCaprio per Traum-Sharing in die Traumwelt anderer hackt: Bislang hat man allenfalls Zugriff auf die eigenen.