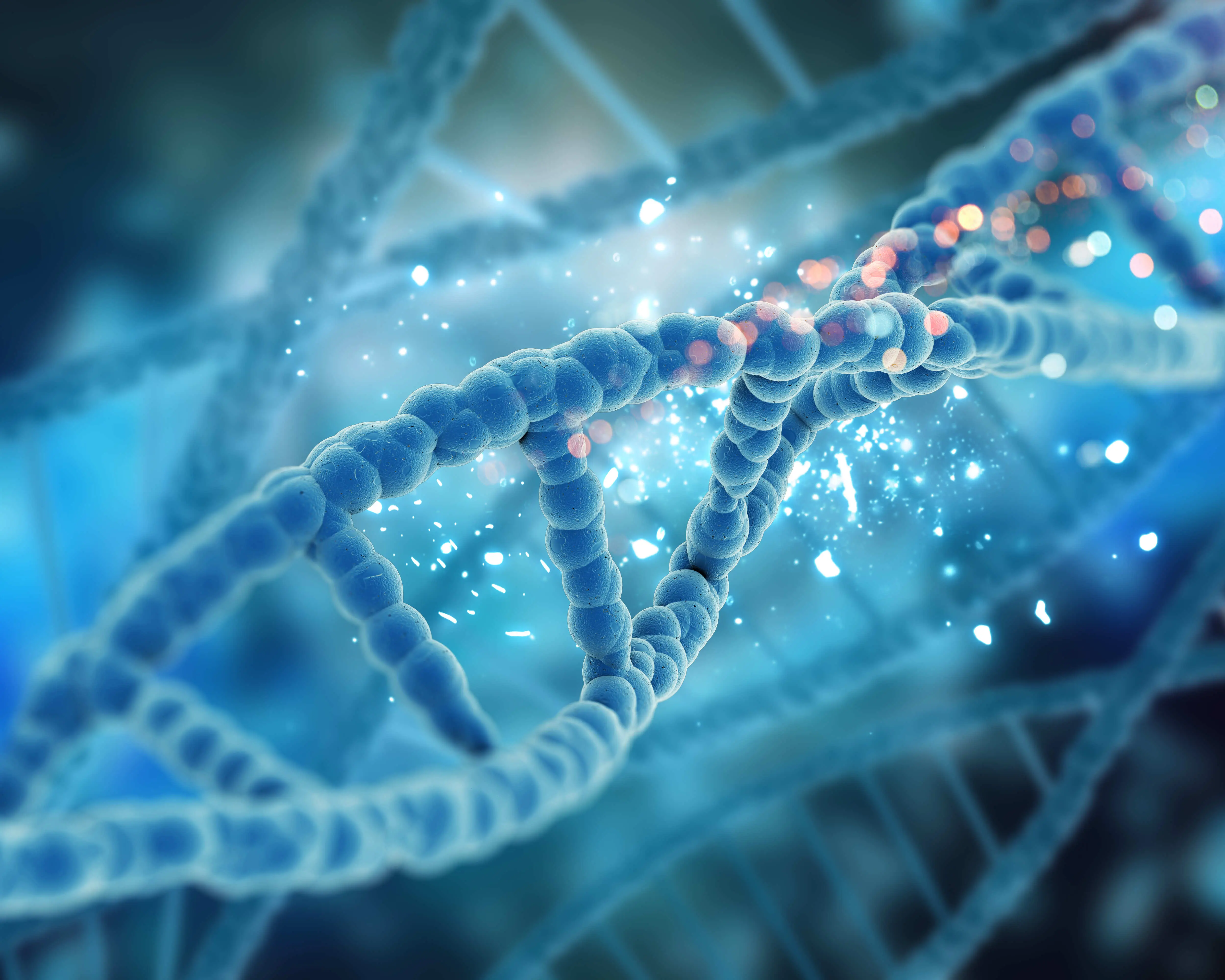
© Freepik
Kann unser genetisches Profil auch die Wirkung von Medikamenten beeinflussen?
29. Juli 2025
Dr. Andrea Gartenbach
- Health
- Longevity
Dr. Andrea Gartenbach: Die Rolle der Gene für ein langes Leben
Dr. Andrea Gartenbach ist Fachärztin für Innere- und Funktionelle Medizin, Expertin für Longevity und ehemalige Leistungssportlerin. In ihrer aktuellen Kolumne für Premium Medical Circle spricht sie über die Chancen der Genetik und warum jeder seine genetische Architektur kennen sollte
Ich begleitete letztes Jahr eine Patientin: Unternehmerin, Anfang vierzig. Sie bewegte sich ausreichend, betrieb Kraftsport, praktizierte Yoga, aß gesund und meditierte regelmäßig. Man könnte sagen, sie machte vieles richtig. Und doch war da diese ständige Angespanntheit – eine diffuse innere Unruhe. Nicht krank, aber auch nicht voll leistungsfähig und im Gleichgewicht.
„Ich funktioniere“, sagte sie. „Aber gerade eben noch so.“ Ihre Blutwerte waren unauffällig. Der Wendepunkt kam, als wir einen umfassenden Gen- und Hormonstatus durchführten.
Sie trug eine COMT-Variante mit verminderter Enzymaktivität. COMT steht für Catechol-O-Methyltransferase, ein Enzym, das eine wichtige Rolle im Abbau von Katecholaminen wie Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin spielt. Das bedeutet, ihr Körper baute Stresshormone und Östrogene langsamer ab.
In Kombination mit einer beginnenden Östrogendominanz in der Perimenopause hatte das besondere Relevanz: Ein verlangsamter Östrogenabbau kann dazu führen, dass vermehrt reaktive, potenziell toxische Metaboliten entstehen. Dadurch erhöht sich das Risiko für hormonbedingte Beschwerden und langfristig auch für Erkrankungen wie hormonabhängigen Brustkrebs. Noch dazu hatte sie jahrelang in bester Absicht das Antioxidans Quercetin eingenommen – ein Stoff, der COMT zusätzlich hemmt und die Problematik verstärkt.
So kann man genetische Prädispositionen erkennen und optimieren
Wir passten ihre Routinen an: Magnesiumpräparate für das Nervensystem, ein anderes Supplementprofil, Fokus auf Phase-II-Detox und ein achtsames Zyklus-Monitoring. Nach drei Monaten fühlte sie sich deutlich besser. Die Ängste und die innere Unruhe waren verschwunden. Auch ihr Hormonprofil war deutlich balancierter. Diese Erfahrung steht exemplarisch für das, was moderne Genetik leisten kann.
Viele Menschen denken bei Genetik an festgelegte Risikogene wie BRCA1/2 – Mutationen, die mit einem deutlich erhöhten Brustkrebsrisiko einhergehen und oft schwerwiegende medizinische Entscheidungen nach sich ziehen. Andere Varianten wie ApoE4, die mit einem höheren Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer assoziiert sind, wirken auf den ersten Blick ähnlich dramatisch – sind aber deutlich besser modulierbar.
Gerade ApoE4 zeigt, wie sehr Lebensstilfaktoren wie Entzündungsreduktion, Schlafqualität, Blutzuckerregulation, Bewegung und kognitive Stimulation die Genexpression beeinflussen können. Durch das Wissen um diese Variante können wir gezielt gegensteuern.

Dr. Andrea Gartenbach: „Gene liefern keine Gewissheiten – aber klare Hinweise. Und die Chance, gezielt zu agieren”
Aber was, wenn wir nicht nur das genetische Potenzial kennen – sondern auch, was davon gerade tatsächlich aktiv ist?
Die eigentliche Revolution der Präzisionsmedizin liegt im Bereich der sogenannten SNPs – kurz für Single Nucleotide Polymorphisms – kleinen genetischen Variationen, die häufig übersehen werden. Sie zeigen, wie individuell unser Stoffwechsel funktioniert und welche Risiken wir frühzeitig erkennen können. Die Datenmenge ist überschaubar, die Auswertung unkompliziert – und deutlich günstiger als eine Vollgenom-Sequenzierung.
Einige SNPs betreffen sogenannte Lifestyle-Prozesse:
- MTHFR: beeinflusst, wie gut wir Folsäure in ihre aktive Form umwandeln, relevant für Zellregeneration, Entgiftung, Hormonbalance.
- CYP1A2: bestimmt, ob Koffein uns aktiviert oder eher belastet.
- COMT: beeinflusst, wie im Fall meiner Patientin, sowohl den Abbau von Stresshormonen als auch von östrogenähnlichen Stoffwechselprodukten.
Moderne Präzisionsmedizin und Genetik
Spannend ist auch die Pharmakogenetik – also die Frage, wie unser genetisches Profil die Wirkung von Medikamenten beeinflusst. Bestimmte Enzyme wie CYP2D6 oder CYP2C19 sorgen dafür, dass Medikamente schneller oder langsamer abgebaut werden. Zwei Menschen können das gleiche Medikament in der gleichen Dosierung einnehmen und völlig unterschiedliche Wirkungen oder Nebenwirkungen erleben. Das ist kein theoretisches Problem, sondern Alltag in der Klinik. Und einer der Hauptgründe, warum „Trial-and-Error“-Therapien zunehmend von personalisierten Strategien abgelöst werden.
Die moderne Präzisionsmedizin geht heute noch weiter. Statt nur auf das Genom zu schauen, beziehen sogenannte Multiomics-Ansätze weitere biologische Ebenen mit ein:
- das Epigenom (z. B. epigenetische Uhren)
- das Metabolom (aktueller Stoffwechselstatus)
- das Proteom (z. B. Entzündungs- oder Reparaturmarker)
Diese Daten zeigen, welche Gene gerade abgelesen werden und welche inaktiv sind. Besonders spannend sind epigenetische Tests wie die Horvath Clock oder organbezogene Alterungsuhren (für Herz, Gehirn oder Haut). Sie machen biologische Veränderungen messbar – oft, bevor Symptome überhaupt auftreten. Damit funktionieren sie wie ein präzises Feedbacksystem für unseren Lebensstil.
Langlebigkeit liegt nicht in den Genen, sondern ist eine tägliche Entscheidung
Die Zukunft liegt in einer Medizin, die nicht reagiert, sondern antizipiert.
Wer seine genetische Architektur kennt – und versteht, wie Ernährung, Bewegung, Schlaf und gezielte Supplementierung darauf wirken – trifft bessere Entscheidungen. Jeden Tag.
Und was sich jede:r bewusst machen sollte: Eine der bisher größten Analysen zur menschlichen Langlebigkeit hat gezeigt, dass nur rund 7 % genetisch vorgegeben sind – der Rest ist Fullgevity. Wir haben es also zu über 90 % selbst in der Hand, unsere Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Vitalität bis ins hohe Alter zu gestalten. Langlebigkeit beginnt nicht im Gen – sondern in der täglichen Entscheidung.















